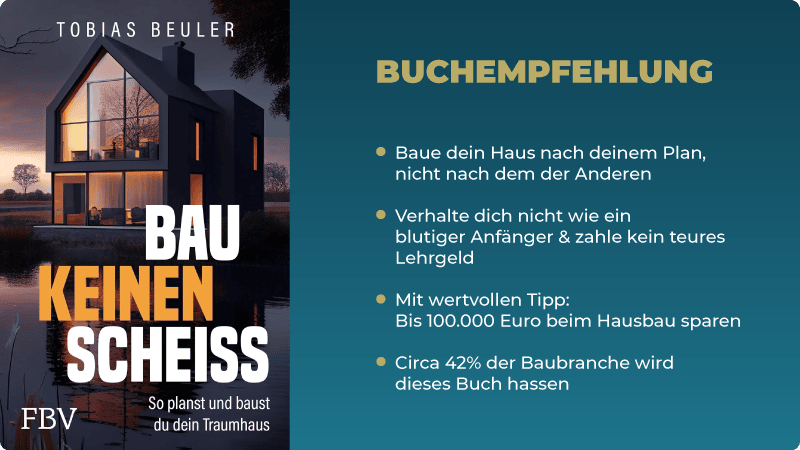Ja, eine Luftwärmepumpe gilt als umweltfreundliche Heizungsoption, da sie erneuerbare Energie aus der Umgebungsluft nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen reduziert sie den CO2-Ausstoß und trägt somit zur Verringerung des Treibhauseffekts bei.
 Autor: Tobias Beuler - Fertighausexperte
Autor: Tobias Beuler - Fertighausexperte
Kategorie: Fertighaus Anbieter
Datum: 13. Dezember 2022
Kommentare: 0
Inhaltsverzeichnis
Beim Hausbau muss früher oder später eine Entscheidung für ein Heizungssystem getroffen werden. Mit dieser Thematik müssen sich aber nicht nur Häuslebauer befassen, sondern auch alle diejenigen, die ihre eigenen vier Wände mit einer alten Anlage beheizen. Mit unserem Ratgeber möchten wir Fragen rund um die Technologie beantworten.
Was ist eine Luftwärmepumpe?
Mit einer Luft-Wärmepumpe wird die Umgebungsluft zum Heizen genutzt. Unterschieden wird hierbei in Wärmepumpen, die ihre Energie aus dem Erd- und Wasserreich beziehen. Im Gegensatz zu einer Gas- oder Ölheizung arbeiten Wärmepumpen mit Umweltwärme und sind somit unabhängig von fossilen Brennstoffen.
Dies macht das Heizungs-System umweltschonend und beliebt bei Neubauten und bei Sanierungen. Luft kann mithilfe der Wärmepumpe einfach für die Heizung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Aus diesem Grund sind Luftwärmepumpen in Deutschland weit verbreitet.
Wie funktioniert eine Luftwärmepumpe?
Die Frage kann einfach beantwortet werden. Thermische Energie aus der Umgebungsluft wird von Luft-Wärmepumpen in Heizwärme umgewandelt. Kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, wird das Wasser erwärmt, welches anschließend in den Heizkreislauf gelangt. Anders sieht es bei der Luft-Luft-Wärmepumpe aus. Hier werden warme Luftströme in der Heizung erzeugt, die für die nötige Temperatur in den Räumen sorgen.
Mit Recht kann hier jedoch die Frage gestellt werden, wie eine Wärmepumpe es schafft Außentemperaturen von 5 Grad oder weniger auf eine Raumtemperatur von 22 Grad zu bringen. Dies funktioniert durch ein Kältemittel wie zum Beispiel Fluorkohlenwasserstoffe mit einem sehr niedrigen Siedepunkt.
Das Kältemittel, welches kälter als die Außentemperatur ist, fließt durch Leitungen in die Wärmepumpe. Ein Ventilator nimmt Umgebungsluft auf. Dies heizt mittels thermischer Energie das Kältemittel auf, welches dann verdampft. Jetzt kommt der sogenannte Dampf Verdichter zum Einsatz. Dieser komprimiert den Dampf des Kältemittels, wodurch seine Temperatur in der Heizung steigt. Diese wird dann an den Heizkreislauf im Gebäude abgegeben.
Mit einer Luft-Wärmepumpe kann das Gebäude nicht nur durch Wärmeübertragung beheizt werden. Es ist möglich im Sommer das Haus auch abzukühlen. Dazu muss die Funktionsweise der Wärmepumpe umgedreht werden. Dabei wird der Raumluft die thermische Energie entzogen und an die Umwelt abgegeben. Die Räume kühlen dadurch ab.
Bis zu welcher Außentemperatur funktioniert eine Luftwärmepumpe?
Entscheidender Faktor hierbei ist die Temperaturdifferenz von Außenluft zu Kältemittel. Je höher die Differenz ist, umso effizienter funktioniert die Luft-Wärmepumpe. So kann die Wärmepumpe bei kalten Außentemperaturen von -20 Grad die Funktion aufrecht erhalten und die Wärmeversorgung des Hauses garantieren. Luft-Wärmepumpen benötigen dafür Energie in Form von elektrischem Strom, was sich jedoch nicht auf die Heizwärme auswirkt.
Vor- und Nachteile einer Luftwärmepumpe
Bevor eine Entscheidung für oder gegen Luft-Wärmepumpenart getroffen wird, ist es wichtig, sich einen Überblick über die Vorteile sowie die Nachteile des Heizungssystems zu verschaffen.
Vorteile von Luftwärmepumpen
Durch Einbindung kostenloser Umweltenergie und gesonderter Stromtarife sind die Heizkosten niedrig.
Wirkungsgrad von ca. 400 % erreichbar.
Fossile Brennstoffe werden geschont – ein wichtiger Vorteil.
Deutliche Reduzierung von CO2-Emissionen
Kein Gas, Öl und keine Emissionen im Haus – somit kein Schornstein nötig.
Zusätzliche Kühlfunktionsmöglichkeit (reversible Betriebsweise).
Nachteile von Luftwärmepumpen
Eventuell ein Pufferspeicher nötig, um vereiste Luft Wärmetauscher abzutauen bzw. um Sperrzeiten von Energieversorgern zu kompensieren.
Oberhalb von 55 Grad Warmwassertemperatur ein integrierter elektrischer Heizstab erforderlich – zum Schutz vor Legionellen.
Einhaltung von Schallschutz Grenzwerte durch geeigneten Aufstellort.
Wartungsaufwand durch regelmäßige Kontrolle des Kältemittels- und Heizkreislaufes.
50 % weniger Förderung als bei einer Sole Wärmepumpe.
Was kostet eine Luftwärmepumpe?
Je nach gewähltem Modell liegen die Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe zwischen 10.000 € bis 16.000 €. Hinzu müssen die laufenden Stromkosten für den Betrieb addiert werden. Diese liegen bei einer Luftwärmepumpe höher als bei einer Grundwasser- oder Erdwärmepumpe.
Wie hoch sind die Betriebskosten?
Für die Wärmequelle muss bei der Wärmepumpen-Technik nichts bezahlt werden, denn es kommt kostenlose Wärmeenergie aus der Umwelt zum Einsatz. Allerdings benötigen der Heizkreislauf, der Kompressor sowie ein zusätzlicher Heizstab für den Winter bzw. für hohe Warmwassertemperaturen Strom. Bei richtiger Auslegung belaufen sich die Kosten für den Stromverbrauch auf ca. 2 % der Jahresheizkosten für ein Zuhause.
Leistung
Stromverbrauch (JAZ – 3 bei 2000 Heizstunden)
5,4 kWh
3.600 kWh
7,9 kWh
5.267 kWh
9,9 kWh
6.600 kWh
11,9 kWh
7.933 kWh
Förderung von Luftwärmepumpen
Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gibt es seit Januar 2021 attraktive Fördermittel für eine Wärmepumpe.
Wird eine Wärmepumpenheizung eingebaut, betragen die Zuschüsse 35 Prozent. Wird durch die Umweltheizanlage eine Gasheizung ergänzt, betragen die Zuschüsse 30 Prozent. Soll eine alte Ölheizung ausgetauscht werden, sind über die Bundesförderung für effiziente Gebäude Zuschüsse von 40 bis 45 Prozent möglich. Bei einem individuellen Sanierungsfahrplan gibt es einen Extrabonus von 5 Prozent.
Restliche offene Kosten müssen aus eigener Tasche bzw. können mit einer speziellen Kreditvariante mit hohen Tilgungszuschüssen über die BEG-EM-Förderung bezahlt werden.
Welche Arten von Luftwärmepumpen gibt es?
Bei den Luftwärmepumpen wird in zwei Arten unterschieden. Im Folgenden zeigen wir die Unterschiede jeder Wärmepumpenart auf.
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wird die Wärme der Außenluft und die Sonne genutzt. Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen dazu eine Außeneinheit im Garten, die in der Lage ist die Außenluft anzusaugen.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann sowohl in Altbauten als auch in Neubauten mit einem niedrigen Dämmstandard installiert werden. Für den Betrieb sind Heizkörper im Altbau oder eine Fußbodenheizung im Neubau nötig. Mit einer solchen Wärmepumpe kann neben der Heizwärmeerzeugung auch die Warmwasserbereitung übernommen werden. Es ist kein weiteres Heizsystem nötig, denn die Luftwärmepumpe ist die All-in-one-Lösung zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.
Luft-Luft-Wärmepumpe
Für Luft-Luft-Wärmepumpen wird zum Heizen die warme Abluft der Wohnräume als Energiequelle genutzt. Die Wärmeenergie wird über die Luft und nicht über einen Heizkreislauf übertragen. Es sind weder Heizkörper noch eine Fußbodenheizung nötig. Bei der Luft-Luft-Wärmepumpe handelt es sich daher um ein reduziertes Heizkonzept mit geringem Platzbedarf. Die Luft-Luft-Wärmepumpe ist in der Regel Teil einer leistungsstarken Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Die Leistung zum Heizen ist deutlich geringer als bei anderen Wärmepumpen, weshalb eine solche Anlage in erster Linie in Niedrigenergiehäusern oder Passivhäusern zum Einsatz kommt. Bei solchen Häusern ist die Gebäudehülle sehr gut gedämmt und es geht nur wenig Wärme über Dach und Außenwände verloren – eine sehr wichtige Bedingung.
Für Altbauten ist eine solche Anlage nicht geeignet. Zudem sind Luft-Luft-Wärmepumpen deutlich wartungsintensiver als andere Wärmepumpen.
Bauweise von Luftwärmepumpen
Die Luftwärmepumpe gibt es in der Kompakt- und Split-Bauweise. In einem Kompaktgerät sind alle Komponenten enthalten. Es besteht die Möglichkeit, die Anlage sowohl innen als auch außen aufzustellen. Bei einer Aufstellung in den Innenräumen bezieht die Anlage die Außenluft über Kanäle, welche durch eine Außenwand führen.
Bei der Split-Bauweise gibt es eine Außen- und eine Inneneinheit. Der Dampf Verdichter befindet sich vor dem Haus in einem Außengerät, während alle anderen Funktionen von der Inneneinheit übernommen werden. Die Luftwärmepumpe in Split-Bauweise ist platzsparender. Es sind keine Mauerdurchbrüche nötig. Damit die Lautstärke der Wärmepumpe reduziert werden kann, ist es wichtig einen optimalen Aufstellort zu finden.
Luft-, Sole- und Grundwasser-Wärmepumpen im Vergleich – Effiziente Heizsysteme für Gebäude
Die Wahl des richtigen Heizsystems spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Effiziente Gebäude-BEG-Richtlinien zeigen, dass umweltfreundliche und effiziente Heizlösungen wie Luft-, Sole- und Wasserwärmepumpen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Systeme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktionsweise, der Nutzung der Wärmequellen und den spezifischen Bedingungen, unter denen sie am effektivsten arbeiten.
Luftwärmepumpen: Luftwärmepumpen extrahieren Wärme aus der Umgebungsluft und nutzen diese zum Heizen von Gebäuden. Diese Systeme sind weit verbreitet, da sie relativ einfach zu installieren und kostengünstig in der Anschaffung sind. Monoblock-Wärmepumpen, bei denen alle Komponenten in einer Außeneinheit zusammengefasst sind, sind ein gängiges Modell dieser Art. Luftwärmepumpen funktionieren auch bei niedrigeren Außentemperaturen, allerdings mit abnehmender Effizienz.
Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärmepumpen): Die Sole-Wärmepumpe, oft als Erdwärmepumpe bezeichnet, nutzt die relativ konstante Temperatur des Erdreichs. Diese Systeme sind für ihre hohe Effizienz bekannt, insbesondere in Gebieten mit günstigen geologischen Bedingungen. Sie erfordern jedoch eine größere Anfangsinvestition und genügend Platz für die Installation der Erdkollektoren oder Erdsonden.
Grundwasser-Wärmepumpen: Bei Wasserwärmepumpen wird Wärme aus dem Grundwasser gezogen. Diese Pumpen bieten eine hohe Effizienz, da das Grundwasser eine relativ konstante und oft höhere Temperatur als die Luft oder das Erdreich hat. Die Voraussetzung der Nutzung ist jedoch, dass ausreichend Grundwasser von guter Qualität verfügbar ist und entsprechende rechtliche Bedingungen erfüllt sind.
Vergleich der Heizsysteme
| Heizsystem | Effizienz (durchschnittlich) | Installationskosten (€) | Betriebskosten/Jahr (€) | Umweltfreundlichkeit |
| Luftwärmepumpe | Sehr hoch (COP 3-4) | 10.000 – 16.000 | 800 – 1.200 | Sehr hoch |
| Gasheizung | Mittel | 6.000 – 12.000 | 1.200 – 1.800 | Mittel |
| Ölheizung | Mittel | 5.000 – 10.000 | 1.500 – 2.500 | Niedrig |
Erläuterungen
Worauf soll ich bei einer Luftwärmepumpe achten?
Der Kauf einer Luftwärmepumpe stellt eine große Investition dar. Daher sollte der Kauf gut überlegt sein. Eine qualitativ hochwertige Luftwärmepumpe lässt sich am EHPA-Gütesiegel erkennen. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass die Wärmepumpe eine JAZ von mindestens 2,5 erreicht.
Da es in einem beheizten Raum leicht zur Bildung von Kondensation kommt, sollte die Luftwärmepumpe möglichst in einer Garage, dem Keller oder im Technikraum aufgestellt werden. Kondenswasser kann hier frostfrei abgeleitet werden. Zusätzlich sollte der Heizraum regelmäßig belüftet werden, damit die relative Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden kann.
Planung einer Luftwärmepumpe
Beim Neubau sollte unbedingt über den Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nachgedacht werden. So kann das Haus von Anfang an günstig und umweltfreundlich beheizt werden.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich aber nicht nur für den Neubau, denn auch im Altbau kann sie effizient genutzt werden. Wichtig dabei ist, dass das Haus gut isoliert ist. So verbraucht die Pumpe weniger Strom, um das Haus aufzuheizen.
Vor dem Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe muss eine behördliche Genehmigung eingeholt werden, die allerdings nicht so umfangreich ist wie einer Erdwärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe). In jedem Fall sollte ein entsprechender Platz für die Anlage innerhalb des Grundstücks eingeplant werden.
Aufstellungsort finden
Hier bestehen zwei Möglichkeiten. Zum einen die Innenaufstellung und zum anderen die Außenaufstellung, die weniger kompliziert ist. Bei der Innenaufstellung müssen Rohre durch die Außenwände gelegt werden, damit die Luft aufgenommen werden kann.
Auf Schallschutz beachten
Der Eigentümer muss bei der Außenaufstellung die rechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz beachten. Damit der Schallschutz gewährleistet ist, muss der Aufstellort sorgfältig gewählt werden. Dies gilt insbesondere in Reihenhaussiedlungen mit dichter Bauweise.
Die Heizlast berechnen
Eine Reihe von Faktoren bestimmen die Größe der Luftwärmepumpe. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Heizlast, also dem Warmwasserbedarf sowie die Vorlauftemperatur der Heizung. Die Heizlast wird in Kilowatt (kWh) gemessen und nach der DIN EN 12831 berechnet.
Für die Berechnung muss der Standort des Hauses berücksichtigt werden, da je nach Klima mehr oder weniger Heizleistung nötig ist. Ebenfalls Auswirkungen auf die Heizlast haben die Wohnfläche und die Dämmung des Hauses.
Kann ich eine Luftwärmepumpe mit anderen Geräten kombinieren?
Eine Kombination mit anderen Geräten ist durchaus sinnvoll.
Photovoltaik: Hiermit kann der nötige Strom für die Luftwärmepumpe selbst produziert werden. Die Cos-Bilanz geht somit auf Null.
Solarthermie: Damit wird der Anteil der Heizenergie, die für die Wärmepumpe nötig ist, reduziert.
Gasheizung: Anstelle des elektrischen Heizstabes wird die Wärmequelle Gasheizung, Öl oder auch der Pelletofen verwendet.
Kamin: Auch hier kann durch den Kamin der Einsatz des elektrischen Heizstabes reduziert werden.
Pufferspeicher: Die Luftwärmepumpe kann dadurch effizienter arbeiten, da erzeugte Energie von wärmeren Tagen gespeichert und in der kalten Nacht genutzt werden kann.
Vorurteile gegen Luftwärmepumpen erklärt
Es gibt immer noch eine Reihe von Vorurteilen. Auf einige möchten wir eingehen.
Luftwärmepumpen fressen Strom
Kritiker behaupten immer noch, dass eine Luftwärmepumpe zu viel kwh Stromverbrauch hat. Dies ist falsch, denn bei richtiger Planung und Auslegung kann die Wirtschaftlichkeit gewährleistet werden.
Luftwärmepumpen sind laut
Auch hier kann mit der richtigen Planung und Auslegung die Geräuschentwicklung weitestgehend reduziert werden.
Luftwärmepumpen sind nicht umweltfreundlich
Oft wird behauptet, dass eine Luftwärmepumpe nur umweltfreundlich ist, wenn sie mit Ökostrom betrieben wird. Dies stimmt so nicht. Im deutschen Strommix sind etwa 25 % Strom aus erneuerbaren Energien enthalten. Dadurch leisten Luftwärmepumpen ab einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 2 schon einen Beitrag zum Klimaschutz.
Unser Fazit – Wann lohnt sich eine Luftwärmepumpe?
Sobald die Temperaturen der Umweltwärmequelle hoch und die Vorlauftemperaturen im Haus niedrig sind, lohnt sich die Anschaffung einer Luftwärmepumpe. Grund hierfür ist, dass die Anlage dann wenig kwh Strom verbraucht und somit die Heizkosten gering bleiben.
Nicht zu vergessen ist die staatliche Förderung für eine Luftwärmepumpe, die die Anschaffungskosten deutlich reduziert.
FAQs zum Thema Luftwärmepumpe
Benötigt eine Luftwärmepumpe viel Platz im Außenbereich?
Eine Luftwärmepumpe benötigt einen gewissen Platz im Außenbereich, um die erforderliche Luftzirkulation zu gewährleisten. Die genaue Größe hängt von der Leistung der Wärmepumpe ab. In der Regel werden die Außeneinheiten an einer Außenwand oder auf dem Dach installiert. Es ist ratsam, vor der Installation die spezifischen Platzanforderungen mit einem Fachmann zu besprechen, um sicherzustellen, dass genügend Platz vorhanden ist.
Kann eine Luftwärmepumpe auch im Sommer kühlen?
Ja, viele Luftwärmepumpen sind sogenannte “Luft-Luft-Wärmepumpen” und können auch für die Kühlung verwendet werden. Sie entziehen dem Innenraum die Wärme und geben diese an die Außenluft ab, wodurch ein kühlender Effekt entsteht. Dies kann eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Klimaanlagen sein.
Sind Luftwärmepumpen laut?
Moderne Luftwärmepumpen sind in der Regel leiser als ältere Modelle. Dennoch erzeugen sie bei Betrieb einen gewissen Geräuschpegel, insbesondere wenn der Ventilator arbeitet. Die genaue Lautstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bauweise der Wärmepumpe und der Entfernung zum Gebäude. Es ist ratsam, sich bei der Auswahl einer Luftwärmepumpe nach dem Schalldruckpegel (gemessen in Dezibel) zu erkundigen.
Wie hoch sind die Kosten für den Betrieb einer Luftwärmepumpe?
Die Kosten für den Betrieb einer Luftwärmepumpe variieren je nach Energiepreisen, Gebäudegröße, Isolierung und individuellem Heizverhalten. Luftwärmepumpen gelten jedoch im Allgemeinen als kosteneffiziente Heizlösung. Durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen kann langfristig eine Reduzierung der Heizkosten erreicht werden. Es ist empfehlenswert, vor der Installation einer Luftwärmepumpe eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.
Benötigt eine Luftwärmepumpe regelmäßige Wartung?
Ja, eine regelmäßige Wartung der Luftwärmepumpe ist wichtig, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dies umfasst unter anderem die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Filter und die Inspektion der Komponenten. Es wird empfohlen, die Wartung von einem Fachmann durchführen zu lassen, der sich mit Luftwärmepumpen auskennt.
Als Experte für den Fertighausbau widmet sich Tobias Beuler, der Gründer von Fertighausexperte, allen Fragen rund um Ihr Bauprojekt.
Technisch ausgebildet von der HWK, kaufmännisch ausgebildet von der IHK und weitergebildet im WBZ der Universität St. Gallen sowie vom Bundesverband deutscher Fertigbau, begleitet Tobias Beuler seit 2000 europaweit den Auf- und Ausbau von Fertighäusern. Nachdem er jahrelang selbst auf Baustellen tätig war, bietet er sein Insiderwissen über Fertighausexperte.com seit 2018 an, um Andere bei Ihren Fertigbauprojekten zu unterstützen und ist in TV und Print als Bauexperte bekannt.
Auf unserer Website erhalten Sie kostenlose Tipps rund rum den Fertighausbau und können auf Wunsch eine individuelle Betreuung Ihres Bauprojekts buchen. Unsere Experten helfen Ihnen u. a. beim Prüfen von Angeboten und Baubeschreibungen oder dem Optimieren von Werkverträgen, damit Sie Baurisiken mindern können. Zudem besuchen wir Baustellen vor Ort und führen bspw. Rohbaukontrollen durch oder begleiten Hausabnahmen.
Holen Sie sich professionelle Unterstützung und verhindern Sie Bauzeitverzögerungen, Mängel oder lästige Diskussionen um Schadensersatzansprüche. Wir helfen Ihnen.
Shop - Unsere 4 Bestseller



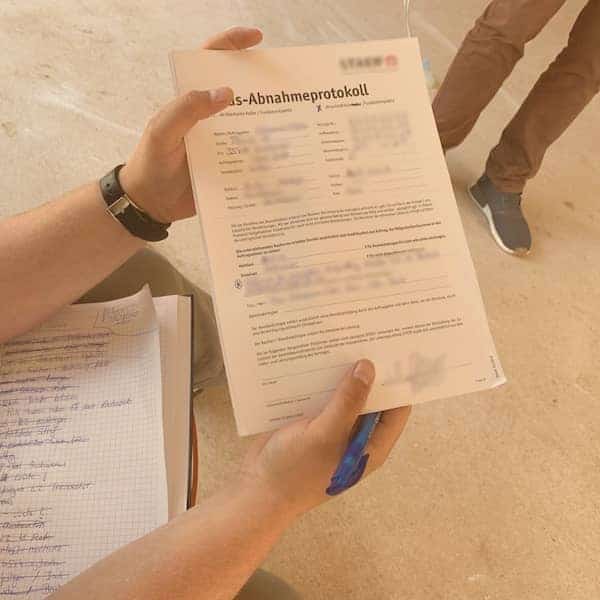
Mehr Informationen zu Fertighäusern und weiteren Themen
Buchempfehlung
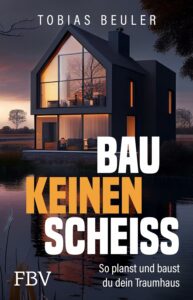
- Baue dein Haus nach deinem Plan, nicht nach dem der Anderen
- Verhalte dich nicht wie ein blutiger Anfänger & zahle kein teures Lehrgeld
- Mit wertvollen Tipp: Bis 100.000 Euro beim Hausbau sparen
- Circa 42% der Baubranche wird dieses Buch hassen